Erfahrungsbericht | gute Praxis: Wissensmanagement – eine Investition in die Zukunft?

Wir leben im Zeitalter der „virtuellen“ Informationsgesellschaft, in der der Umgang mit Wissen für öffentliche Verwaltungen immer wichtiger und herausfordernder wird. Integrationsbezogenes Wissen liegt in verschiedener Form in den öffentlichen Verwaltungen vor, ist aber nicht immer angemessen aufbereitet und für alle beteiligten oder relevanten Akteurinnen und Akteure gleichermaßen transparent und zugänglich. Diese Annahme wurde durch die kritische Auseinandersetzung mit bestehenden Strukturen in öffentlichen Verwaltungen im Fachworkshop „Wissensmanagement in der kommunalen Integrationsarbeit“ im Rahmen des Programms Land.Zuhause.Zukunft am 16.09.2020 untermauert.
Diskutiert haben hierzu Vertreterinnen und Vertreter aus 16 Landkreisen, die im Integrationsbereich tätig sind, gemeinsam mit dem Referenten des Workshops, Prof. Dr. Jürgen Stember. Doch wie sehen Lösungsmöglichkeiten aus? Können und sollten sich Instrumente des Wissensmanagements als Investition für die Zukunft in öffentlichen Verwaltungen durchsetzen? Wie könnte dies aus Sicht der Kommunalverwaltungen gelingen bzw. was stünde dem entgegen? Der folgende Beitrag beleuchtet diese Fragen. Hierfür wird das Thema Wissensmanagement im Sinne einer Investition für die Zukunft skizziert und um die Darstellung von Erfolgsfaktoren und Entwicklungsperspektiven ergänzt, die im Rahmen des LZZ-Fachworkshops diskutiert wurden.
„Wissen ist Macht“, „Personen sind Speichermedien“ und „Wissen ist eine nicht greifbare Währung“: Diese Aussagen stammen von Teilnehmenden des Fachworkshops zum Thema Wissensmanagement. Die Aussagen spiegeln die ambivalente Rolle von Wissen in den Verwaltungen der Landkreise wider: Zwar gilt Wissen als eine machtvolle Ressource in allen Verwaltungen der Teilnehmenden, jedoch wird diese für die Bewältigung der Verwaltungsaufgaben in ihren Landkreisen nur unzulänglich ausgeschöpft.
Der Ursprung der Herausforderung liegt nicht nur an den vielfältigen on- und offline verfügbaren Informationen. Faktoren wie der demografischen Wandel, der dazu führt, dass viel Personal inklusive seines impliziten und expliziten Wissens aus der Verwaltung ausscheidet und nicht immer nachbesetzt wird, spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
Alle Arbeitsbereiche öffentlicher Verwaltungen, insbesondere jedoch der Arbeitsbereich Integration, würden vom Konzept des Wissensmanagements profitieren. Bei der Integration handelt es sich um einen dynamischen Bereich, der verschiedene soziale und rechtliche Themen vereint und in dem eine große Anzahl verschiedener Akteurinnen und Akteure zusammenarbeitet. Hinzu kommt, dass insbesondere der Aufbau von Wissen u.a. in “Krisenzeiten“, wie beispielsweise der Fluchtzuwanderung in den Jahren 2015 und 2016 und der derzeitigen Covid-19 Pandemie, für künftige Herausforderungen nachhaltig gestaltet und das erworbene Wissen gesichert werden sollte. Schließlich stemmen die Verwaltungen durch das Aktivieren ihrer Ressourcen (personeller und struktureller Natur) und dank ihrer Flexibilität seit Jahren zahlreiche Aufgaben im Bereich der Migrations- und Integrationspolitik und erwerben wertvolles Wissen, das es zu speichern und zu teilen gilt.
Doch was bedeutet Wissensmanagement im Einzelnen?
Eingesetzt wird Wissensmanagement, um vorhandenes Wissen gemeinsam weiterzuentwickeln, zu bewahren und weiterzugeben. Es gilt als ein Instrument zur Umsetzung einer nachhaltigen, modernen und innovativen Verwaltungskultur mit offenen, lernenden Strukturen. Die Wissenschaft begreift das Management von Wissen als Instrument zur nachhaltigen Prozessverbesserung, die den Verwaltungen zu einer mittel- und langfristigen Kostenersparnis verhilft. Aufgegliedert ist das Wissensmanagement in drei Säulen: Personal, Organisation und Informationstechnologie (IT). Für die Umsetzung unterscheidet die Wissenschaft folgende Bausteine des Wissensmanagements: Identifikation, Strukturierung, Bewahrung und Bewertung des vorhandenen Wissens.
Handlungsempfehlungen aus Sicht der Wissenschaft:
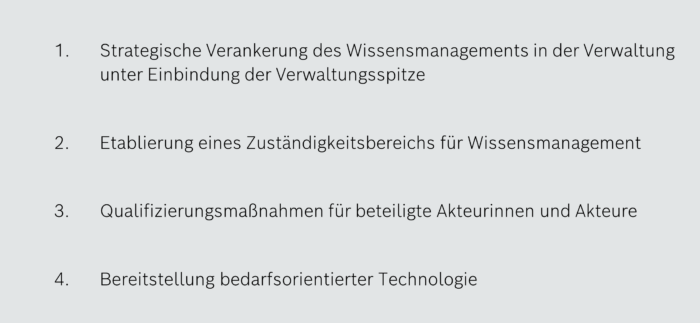
In der Praxis sieht die organisatorische Verortung des Konzepts sehr unterschiedlich aus, da ländliche Kommunen in allen drei Säulen des Wissensmanagements sehr heterogen geprägt sind.
Um einen Einblick in die aktuelle Situation der Verwaltungslandschaft zu erhalten, erörterten die Teilnehmenden des Fachworkshops in Kleingruppen spezifische Herausforderungen, mit denen sie sich in Bezug auf das Thema Wissensmanagement konfrontiert sehen. Diskutiert wurde zu den Themen: „Nachhaltigkeit schaffen – Sicherung vorhandenen Wissens als Grundlage für die Bewältigung zukünftiger Herausforderungen“, „Netzwerke bilden – Mögliche Wissensgeberinnen und Wissensgeber innerhalb und außerhalb der Verwaltung identifizieren“ und zum Thema „Digitalisierung nutzen“ – Chancen des digitalen Arbeitens für das Wissensmanagement erkennen und zielgerichtet nutzen“.
Digitalisierung – ein Querschnittsthema
Verwaltungen bestehen aus einer Vielzahl von Strukturen und beteiligten Organisationen. Hinzu kommen die unterschiedlichen kulturellen und politischen Aspekte ländlicher Räume. Handelt es sich beispielsweise um einen Landkreis oder eine kreisangehörige Gemeinde? Inwieweit unterliegt der Landkreis den Folgen des demografischen Wandels? Wie ist der Integrationsbereich in der Kommunalverwaltung organisiert und koordiniert? Mit welchen beteiligten Organisationen, z. B. aus Zivilgesellschaft oder Wirtschaft, besteht eine Zusammenarbeit? Welche zentralen Personen bestimmen die Politik vor Ort?
Diese Heterogenität ist für die öffentlichen Verwaltungen in den Landkreisen Herausforderung und Chance zugleich. So verschieden die einzelnen Landkreise, so unterschiedlich sind auch die Herausforderungen, mit denen sie sich konfrontiert sehen, sowie die Lösungswege, die sie dafür finden. Das Thema Digitalisierung verbindet als Querschnittsthema alle von den Teilnehmenden diskutierten Herausforderungen. Zugleich eröffnet es neue Chancen. Die Systematisierung von Wissen ist eng mit einer Digitalisierung von Verwaltungstätigkeiten verknüpft. Dies verdeutlicht auch eine der drei Säulen des Wissensmanagements, der Bereich Informationstechnologien.
Die Digitalisierung innerhalb der Verwaltung ist ein wichtiges Ziel von Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Verwaltung. Hierdurch versprachen sich auch alle Teilnehmenden des Fachworkshops insbesondere Lösungsansätze für Probleme in ländlichen Räumen. Besonders die Möglichkeit zur Überwindung eingeschränkter Mobilität und Distanzen, die es in ländlichen Räumen oft zu bewältigen gilt und die durch digitale Lösungen „überbrückt“ werden können, würde es Zugewanderten ermöglichen, sich an städtischen Angeboten (z. B. Beratungen, Migrantenorganisationen) zu beteiligen bzw. diese in Anspruch zu nehmen.
Die Digitalisierung der Verwaltung beinhaltet dabei nicht nur die Digitalisierung von Arbeitsabläufen, die durch das Umwandeln einer Handakte in eine elektronische Datei abgeschlossen ist. Vielmehr geht es um einen Organisationswandel technischer und kultureller Natur; ein Organisationswandel, der Vernetzungs- und Kommunikationsaktivitäten steigert und somit auch auf Wissensmanagement abzielt.
Erfahrungen der Landkreise
Erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden von den Teilnehmenden des Workshops als „Speichermedium“ und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als „Impulsgebende“ wahrgenommen. Im 21. Jahrhundert und in Zeiten von Corona erleben wir, wie wichtig die virtuelle Welt, die digitalen Möglichkeiten für unsere Gesellschaft sind, auch um diese beiden Gruppen miteinander vernetzen zu können.
Als große Herausforderung wird derzeit die fehlende Priorisierung des Themas Wissensmanagement angesehen. Dies haben die Themen „Integration“ und „Wissensmanagement“ gemeinsam, denn die Pandemie rückt beide Themen noch weiter als bisher in die Nische eines „Nice to have„, also einer freiwilligen, im Grunde aber verzichtbaren Aufgabe.
In der Praxis sind die meisten Daten und Informationen zwar digital gespeichert, jedoch nicht für alle relevanten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsehbar oder auffindbar. Geschätzt und gebraucht sind Einzelpersonen mit relevantem Wissensschatz. Gleichzeitig sind sie jedoch auch in der Kritik, da sie insbesondere ihr implizites Wissen hüten und bewusst oder unbewusst nicht mit ihren Kolleginnen und Kollegen teilen (können). Bemängelt wird von den Teilnehmenden ein solcher „Wissensegoismus“ auch in Bezug auf die oft hierarchische Verwaltungskultur, die die Weitergabe von Wissen und die Etablierung neuer Strukturen zuweilen ausbremst.
Hinzu kommt der stetige Personalwechsel, der insbesondere in der Projektarbeit vorprogrammiert ist. Der Arbeitsbereich Integration ist geprägt von zeitlich befristeten Projektstellen, die gefördert werden und als „Anschubfinanzierung“ angelegt sind, um Projekte ins Rollen zu bringen, und die anschließend anderweitig finanziert werden sollen. Die Erfahrungen der Teilnehmenden des Fachworkshops zeigen jedoch, dass sich die Anschlussfinanzierung nur selten umsetzen lässt.
Die Vertreterinnen und Vertreter der Landkreise empfinden auch die fehlenden personellen, fachlichen und technischen Ressourcen als Herausforderung. Eine interne und insbesondere organisationsübergreifende Wissensbörse gestalte sich auch und vor allem aufgrund von Fragen rund um den Datenschutz und Zugangsrechte schwierig. Ebenfalls werden einige virtuelle Anwendungen als zu kompliziert wahrgenommen oder dürfen aufgrund verwaltungsinterner Regularien nicht genutzt werden.
Bekannt ist, dass eine digitale Infrastruktur in Deutschland noch unzureichend vorhanden ist. Dies stellt insbesondere in Ballungszentren bei hoher Auslastung und in ländlichen Räumen aufgrund des fehlenden Breitbandausbaus eine Herausforderung dar. In der Wissenschaft wird von einer digitalen Spaltung gesprochen, die neben diesen erschwerten Zugangsmöglichkeiten auch die fehlenden Kenntnisse und Kompetenzen der Akteurinnen und Akteure in den Blick nimmt.
Als Chance nehmen die Teilnehmenden vorhandene Ressourcen und Strukturen der Verwaltungen wahr, die als eine gute Grundlage für das Konzept des Wissensmanagements verstanden werden. Genannt werden beispielsweise dezentrale Dokumentationen (z. B. Akten, Leitfäden und Handreichungen) wie auch Informationssysteme (z. B. das Intranet und vorhandene Datenbanken). In Bezug auf das Konzept des Wissensmanagements erachten die Teilnehmenden insbesondere die Steigerung der Arbeitseffektivität und die Steigerung der Vernetzungsaktivitäten und des Wissensaustauschs als positiv.
Handlungsempfehlungen der Teilnehmenden
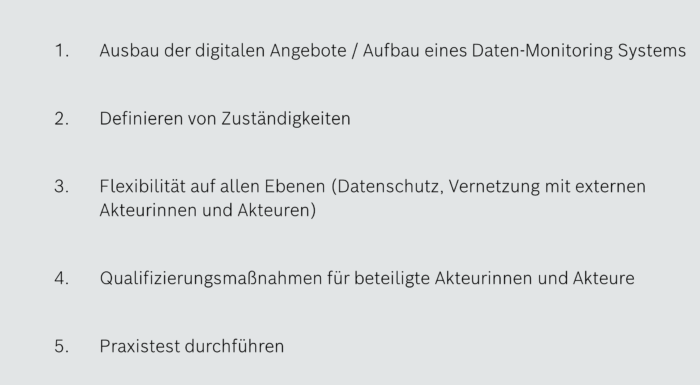
Die Teilnehmenden aus kommunalen Verwaltungen interessieren sich für Strukturen des Wissensmanagements und setzen einige Ansätze bereits um. Sie nutzen vorhandene Strukturen, definieren Zuständigkeiten, betreiben aktive Vernetzung und regelmäßigen Austausch, formulieren Handlungsempfehlungen für die interne und externe Kommunikation, investieren in Qualifizierungsangebote oder verwenden ein Daten-Monitoring-System.
Allerdings fehle es an einer zentralen Plattform oder einer verwaltungsinternen Dachstruktur für das Wissensmanagement, die übergeordnet alle Fachbereiche in den Blick nimmt und als Ansprechpartnerin für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fungiere. Der Wunsch der Teilnehmenden des Fachworkshops bezieht sich nicht nur auf eine zentrale Verteilung der Zuständigkeiten, sondern beinhaltet eine damit einhergehende Transparenz der Strukturen (z. B. der Verwaltungsstrukturen nach außen). Diese kann Frust vorbeugen, der dort entsteht, wo Zusammenarbeit keine sichtbaren Verbesserungen bewirkt. Die Veränderung der oft herrschenden Hierarchien in der traditionellen Verwaltungsstruktur sowie bei der Verteilung von Zuständigkeiten und der Bestimmung von Abläufen ist für einen Organisationswandel durch Wissensmanagement zentral.
Bei dem Wunsch nach einer Digitalisierung des Wissens empfehlen die Teilnehmenden des Fachworkshops, alle Konsequenzen, nicht nur die positiven, in den Blick zu nehmen. Eine stärker digitalisierte Arbeitsweise bringe beispielsweise das Einführen von standardisierten Eingabeformularen mit sich, die nur vorgegebene Antworten und Arbeitsschritte zulassen. Hierdurch käme es zu eingeschränkter Flexibilität und verengten Handlungsspielräumen der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da sie abweichende – evtl. notwendige individuell angepasste – Eingaben nicht tätigen könnten. Einige standardisierte Arbeitsschritte könnten sich negativ auf die Arbeit mit Neuzugewanderten auswirken, beispielsweise im Verfahren um eine Aufenthaltserlaubnis. Bei diesem Verfahren muss jeder Lebensweg individuell betrachtet werden, um eine gleichberechtigte Behandlung Neuzugewanderter auf allen Verwaltungsebenen ermöglichen zu können. Des Weiteren gelte die Schaffung eines Systems zur Informationsweitergabe für die gesamte Organisation mit thematischer Zuordnung als notwendig.
Wissensmanagement – nicht ohne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
Verwaltungen arbeiten auf der Grundlage des dokumentierten Wissens und profitieren von dem Wissensschatz ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die Wünsche und Meinungen von Beschäftigten spielen eine große Rolle, um Wandel zu erklären und zu gestalten. Das Verwaltungshandeln beruht auf der Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und kann nicht unabhängig davon betrachtet werden. Wandel lebt davon, dass neue Arbeitsweisen in der Praxis getestet werden. Nur so kann sich die Arbeit verändern und durch neue Vernetzungs- und Kommunikationsaktivitäten ein Nutzen entstehen. Hier spielt die Flexibilität der IT Systeme, aber auch der Verwaltungen, eine zentrale Rolle, denn Wissen und dessen Verbreitung sind ein organischer Prozess, der sich ständig verändert.
Um Wünsche der Teilnehmenden, beispielsweise das Verabschieden eines transparenten Integrationskonzepts, das die erwünschten Ergebnisse der Maßnahmen festhält, erfüllen zu können, müsste vermehrt in die Etablierung von Wissensmanagement, insbesondere im Sinne der Digitalisierung, investiert werden. Hierfür müssten öffentliche Verwaltungen die dafür erforderlichen technischen Voraussetzungen und personellen Kompetenzen aufbauen. Für eine erfolgreiche Etablierung des Themas Wissensmanagement sollten Zuständigkeiten definiert werden, um eine aktive Vernetzung und einen regelmäßigen Austausch mit internen und externen Akteuren zu ermöglichen. Akteure und Akteurinnen gibt es im Integrationsbereich viele, wie zum Beispiel den Fachbereich Jugend und Soziales, die Agentur für Arbeit, Wohlfahrtsverbände, Bildungseinrichtungen, Unternehmen, (Sport-)Vereine und Ehrenamtliche, um nur einige zu nennen. Ein regelmäßiger Austausch ist unabdingbar, um die unterschiedlichen Logiken verschiedener Verwaltungsbereiche, beispielsweise von Ausländerbehörden und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, aufzuschlüsseln und miteinander vereinbaren zu können.
Fehlen für ein systematisches Wissensmanagement die erforderlichen personellen, finanziellen und technischen Ressourcen, können Verwaltungen zunächst auf einzelne Instrumente des Wissensmanagements zurückgreifen, um ihre Arbeit zu verbessern. Hierfür empfiehlt der Referent des Workshops, Prof. Dr. Jürgen Stember, im Rahmen von Workshops und/oder einer Befragung, Defizite und Ressourcen zu ermitteln, für das Thema zu sensibilisieren und Bedarfe herauszufiltern, um in ein konkretes Ziel investieren zu können. Das angestrebte Ziel sollte jedoch sein, Wissensmanagement als ganzheitlichen Veränderungsprozess einer Verwaltung zu verstehen, bei dem für alle notwendigen Schritte das Einbinden der Verwaltungsleitung unabdingbar ist. Nur so können Gelder für Qualifizierungsangebote beantragt und der Ausbau technischer Systeme ermöglicht werden.
Die kritische Auseinandersetzung mit bestehenden Strukturen und mit dem Umgang mit Wissensbeständen in der Integrationsarbeit kann zu einer guten und effektiven Zusammenarbeit der beteiligten Akteurinnen und Akteuren beitragen. Als Expertinnen und Experten ihrer Kommunen besitzen sie im Themenfeld vielfältige Informationen über Neuzugewanderte (z. B. länderspezifische Informationen sozialer und rechtlicher Art). Durch den Austausch und auf Basis des vorhandenen integrationsbezogenen Wissens könnten die Kommunen Programme (weiter-)entwickeln, die die Bindung neuzugewanderter Menschen an ländliche Regionen erhöhen. Dies kann durch ein effektives Wissensmanagement unterstützt und für die Zukunft verfestigt werden.
In diesem Sinne müssen sich die öffentlichen Verwaltungen überlegen, in welcher Weise Wissensmanagement als ergänzende Strategie für den Integrationsbereich ihrer Landkreise fungieren kann, als eine Investition in die Zukunft.
Julia Lisa Gramsch

